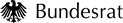Über drei Gesetze und mehrere Verfassungsbeschwerden hatten die acht Richter in Karlsruhe zu entscheiden. Zwei der Gesetze halten sie für vereinbar mit dem Grundgesetz. Dabei handelt es sich um das Zustimmungsgesetz, das den Bundespräsidenten zur Unterzeichnung der Ratifikationsurkunde ermächtigt und das Grundgesetz-Änderungsgesetz. Es nimmt Änderungen an der deutschen Verfassung vor, damit diese den Bestimmungen des Lissabon-Vertrages und seiner Protokolle zu den Rechten der nationalstaatlichen Parlamente entspricht.
Begleitgesetz muss überarbeitet werden
Das so genannte Begleitgesetz (Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union) verstößt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts jedoch gegen das Grundgesetz.

Bundesverfassungsgericht Urteil zum EU-Vertrag
© picture-alliance | dpa
Das Gesetz regelt die Mitspracherechte von Bundesrat und Bundestag im europäischen Entscheidungsprozess. Hierzu gehört auch die so genannte Brückenklausel. Sie ermöglicht die Änderung des Abstimmungsmodus im Rat und lässt damit den Übergang von einstimmigen zu Mehrheitsentscheidungen zu. Bislang sieht das Begleitgesetz vor, dass Bundesrat und Bundestag die Änderung des Abstimmungsverhaltens ablehnen dürfen, soweit sie durch eine entsprechende Entscheidung in ihren Gesetzgebungsbefugnissen betroffen sind.
Die Beschwerdeführer, zu denen der CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Gauweiler und die Bundestagsfraktion Die Linke gehörten, sahen in der gesetzlich vorgenommenen Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union eine Aushöhlung der Kompetenzen des Deutschen Bundestages und damit eine Verletzung des Demokratieprinzips. Das Gericht bestätigte diese Einschätzung. Nach dem Urteil ist das derzeit im Begleitgesetz vorgesehene Ablehnungsrecht von Bundestag und Bundesrat kein Ersatz für die notwendige Zustimmung in einem Ratifizierungsverfahren und schützt Deutschland nicht ausreichend vor unvorhersehbaren Vertragsänderungen. Das Gericht verlangt deshalb, dass die Bundesregierung Initiativen zur Änderung der Abstimmungsmodalitäten nur zustimmen darf, wenn Bundestag und Bundesrat sie zuvor durch Gesetz bzw. durch ausdrückliche Zustimmung dazu ermächtigt haben.

Bundesverfassungsgericht Urteil zum EU-Vertrag
© picture-alliance | dpa
Weiter betonte Karlsruhe, dass die Europäische Union auch nach Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon kein Bundesstaat sein wird. Für die künftige Übertragung von Hoheitsrechten würden enge Grenzen gelten. Der europäische Einigungsprozess dürfe nicht dazu führen, dass das demokratische System Deutschlands ausgehöhlt wird. Deutlich erklärte das Bundesverfassungsgericht, dass die Mitgliedstaaten ihre Lebensverhältnisse weiterhin selbstverantwortlich politisch und sozial gestalten können müssen.
Neues Gesetz bis Ende September
Die Koalitionsfraktionen haben inzwischen angekündigt, das Begleitgesetz noch in der Sommerpause zu überarbeiten. Am 26. August 2009 soll es in einer Sondersitzung in den Bundestag eingebracht werden. Die 2. und 3. Lesung findet wahrscheinlich in einer Sondersitzung des Bundestages am 8. September 2009 statt.

Bundesverfassungsgericht Urteil zum EU-Vertrag
© Bundesrat | Frank Bräuer | 2009
Der Bundesrat wird über seine Zustimmung zu dem Begleitgesetz voraussichtlich in der Sitzung vom 18. September 2009 beschließen. Mit diesem Zeitplan soll sichergestellt werden, dass Deutschland noch vor dem am 2. Oktober 2009 stattfindenden erneuten Referendum in Irland über den Vertrag von Lissabon das Ratifikationsverfahren abschließen kann.
Vom Ausgang des Referendums in Irland hängt auch die Entwicklung in Polen und Tschechien ab. Polens Präsident Lech Kaczyński hat angekündigt, den Vertrag zu unterschreiben, wenn das deutsche Verfassungsgericht und das irische Volk den Vertrag von Lissabon akzeptieren. Tschechiens Präsident Václav Klaus will ebenfalls das irische Referendum sowie die Entscheidung in Polen und eine zweite Prüfung durch das Tschechische Verfassungsgericht abwarten.