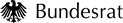Herr Brouër, Sie sind 1945 geboren und haben vom Wiederaufbau bis zur Wiedervereinigung die Entwicklung der Bundesrepublik erlebt. Welche Devise hat ihr Leben bestimmt?
Ein Wahlspruch, der mich auch in meiner beruflichen Laufbahn immer begleitet hat, stammt von Albert Camus und lautet: "Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen". Es mag seltsam klingen, aber wenn ich an die spannende Fülle an Arbeit und Akten in meiner Zeit als Richter oder später im Bundesjustizministerium und insbesondere im Justizministerium Brandenburg denke, dann trifft es die Sache ganz gut.
Sisyphosarbeit hat mich nie abgeschreckt. Ich habe es immer als Herausforderung empfunden, alles abgearbeitet zu haben und dann am nächsten Tag wieder in Akten zu ertrinken.
Sie gingen 1991 vom Bundesjustizministerium in Bonn nach Brandenburg und waren dort Abteilungsleiter im Justizministerium und später Bevollmächtigter des Landes beim Bund. Mit welchen Erwartungen und welcher Motivation sind Sie damals nach Potsdam gegangen?

Interview mit Dirk Brouër
© Bundesrat | 2010
Ich bin 1945 in Halle an der Saale geboren. Jeder Blick in meinen Ausweis machte mir das immer wieder bewusst. Als dann im BMJ gefragt wurde, wer sich vorstellen könne, in die Neuen Länder zu gehen, war für mich klar, dass ich dafür bereit bin. Ich wollte schlicht beim Aufbau helfen.
Meine Erwartungen waren zunächst nicht besonders hoch, ich war einfach offen und - ja - auch neugierig. Was ich dann aber mit gestalten konnte, war eine Vereinigung im Kleinen, nämlich eine Abteilung, die paritätisch mit Mitarbeitern aus Ost und West besetzt war. Das hat mir immer wieder Freude bereitet und - so glaube ich - auch alle meine Mitarbeiter in der Abteilung mit beflügelt, eine Kultur des voneinander Lernens zu pflegen, die uns alle bereichert hat.
Was waren aus Ihrer Sicht die größten Schwierigkeiten beim Zusammenwachsen von Ost und West?
Das waren für mich eindeutig die offenen Vermögensfragen und der Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung. Damit prallten einerseits die Erwartungen und andererseits die Befürchtungen der Betroffenen aus beiden Teilen der Republik aufeinander. Man hat die Menschen dadurch gleichsam gegeneinander in Stellung gebracht. Das war weder gut für das Zusammenwachsen des Landes und in vielen Fällen auch ein großes Hindernis für die wirtschaftliche und auch die städtebauliche Entwicklung. Es war schlicht ein großer Fehler. Meine Abteilung hat sich dann auch besonders für ausgewogene gesetzliche Veränderungen durch Anträge und Initiativen im Bundesrat eingesetzt, wobei ich schon stolz darauf bin, dass alle unsere Erfolge vor dem Bundesverfassungsgericht gehalten haben.
In diesem Jahr feiern wir 20 Jahre Deutsche Einheit. Spüren Sie in Ihrem Lebensumfeld noch Gegensätze zwischen Ost und West?
Selten und wenn, dann sind dies Konflikte und besonders Neid-Debatten, die leider oft durch die Medien gezielt gefördert werden. Ich glaube, das Zusammenwachsen ist in weiten Teilen gut vorangekommen, meine aber, dass dafür letztlich zwei Generationen notwendig sind. Die erste von beiden ist nun schon "erwachsen".
Sie wohnen seit vielen Jahren in Potsdam. Ist die Stadt ihre Heimat geworden?
Ja, das kann ich sagen. Natürlich bestand die Frage, ob ich im Ruhestand mit meiner Frau wieder zurück ins Rheinland oder nach Niedersachsen, wo ich aufgewachsen bin, zurückgehen sollte. Doch die Entscheidung fiel eindeutig aus: Wir bleiben in Potsdam.
Im Mai 2002 wurden Sie Direktor des Bundesrates. Welches waren Ihre ersten Eindrücke im Amt?
Durch meine vorherigen Tätigkeiten war ich mit dem Bundesrat und seinen Ausschüssen und dem Sekretariat bereits vertraut. Was mich dann im Amt besonders beeindruckt hat, war die Souveränität im Umgang mit Vorgängen, die Effizienz der Arbeit und das sehr gute Einvernehmen unter den Bediensteten.
Welche war die schwierigste Situation, die Sie als Direktor des Bundesrates meistern mussten?

Interview mit Dirk Brouër
© Bundesrat | 2010
Das war ein Ereignis, das eher amüsant erscheint: Als Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren ersten Besuch im Bundesrat machte, geleitete ich sie zu ihrem Platz auf der Regierungsbank und ging von dort zu meinem Platz im Präsidium. Noch auf dem Weg dorthin rief der damalige Vizekanzler Franz Müntefering nach mir. Beim Umdrehen sah ich, dass eine Lehne am Stuhl von Frau Merkel gebrochen war. Das war ziemlich peinlich! Eine Zeitung schrieb daraufhin "Wer hat an Merkels Stuhl gesägt?". Ich kann versichern, keiner, es war ein Ermüdungsbruch! Wir haben danach sämtliche Stühle überprüfen und die Lehnen austauschen lassen.
Ansonsten war es immer spannend in der zweiten Hälfte der Amtszeit der Präsidenten. Sie werden jeweils für ein Jahr gewählt und leiten in dieser Zeit die Plenarsitzungen. Im ersten Halbjahr halten sie sich meist an die Regeln und Vorgaben für die Sitzungsleitung. Nach der vierten oder fünften Sitzung jedoch schwimmen sie sich langsam frei und dann muss man aufpassen, dass die im Gesetzgebungsverfahren formal notwendigen Dinge in der Sitzung auch verlesen werden - selbst dann, wenn die Passagen simpel oder überflüssig erscheinen. Wenn dann die Sitzungsleitung allzu frei geriet, brachte mich das einige Male ins Schwitzen.
Sie haben als Direktor insgesamt neun Präsidenten zur Seite gestanden. Hat sich der jährliche Wechsel des Präsidentenamtes aus Ihrer Sicht bewährt?
Das lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Nehmen wir das Beispiel vom Zusammentreffen auf internationalen Konferenzen. Präsidenten aus Parlamenten, bei denen der Vorsitz weniger häufig wechselt, kennen sich natürlich von vielfältigen Anlässen. Da mag es ein Nachteil sein, dass der Bundesratspräsident nur ein Jahr im Amt ist.
Andererseits ist diese Rotation ein wichtiger Ausdruck für die Gleichberechtigung der Länder. Würde man den Zeitraum der Präsidentschaft verlängern, würde es bei 16 Ländern mitunter Jahrzehnte dauern, bis ein Land den Präsidenten stellen kann. Das wäre unzumutbar. Deswegen hat sich das bestehende Prinzip bewährt, und es sollte auch so bleiben.
In Zeiten unterschiedlicher Mehrheitsverhältnisse in Bundestag und Bundesrat wird dem Bundesrat gern vorgeworfen, er sei ein Blockadeinstrument der Bundestagsopposition. Wie viel Parteipolitik verträgt der Bundesrat?

Interview mit Dirk Brouër
© Bundesrat | 2010
Im Bundesrat gibt es keine Fraktionen und seine spezifische Aufgabe ist es, die Interessen der Länder in die Bundes- und die europäische Gesetzgebung einzubringen. Dabei sind die Interessen der Länder zunächst einmal parteipolitisch unabhängig. Nehmen sie etwa die Bereiche Energiegewinnung, Schiffbau oder Weinanbau. Bei diesen Themen vertreten die Länder ihre eigene Linie - ohne Einfluss der Parteipolitik. Diese spielt nur dann eine Rolle, wenn Wahlen zum Bundestag anstehen - und das auch nur bei populären und gesellschaftlich umstrittenen Gesetzesvorhaben.
Wenn der Bundesrat einem Gesetzesbeschluss mal die Zustimmung verweigert, kommt es meist im anschließenden Vermittlungsverfahren mit dem Bundestag doch noch zu einem Gesetz. Nur bei 0,7 Prozent der Fälle wurde bisher keine endgültige Einigung gefunden. Außerdem haben die Ergebnisse der Vermittlungsverfahren bewiesenermaßen länger Bestand, als man sich das zunächst vorgestellt hat.
Den Blockadevorwurf halte ich deshalb für verfehlt. Die notwendigen Vermittlungsverfahren und die Suche nach Konsens sind von unserer Verfassung ausdrücklich gewünscht.
Hat sich die Rolle des Bundesrates seit 1949 bis heute verändert?
Es gab Verfassungsänderungen zum Gesetzgebungsverfahren, etwa durch die Föderalismusreformen in den letzten Jahren. Prinzipiell hat sich die Rolle des Bundesrates in der Gesetzgebung nach meiner Auffassung nicht verändert.

10 Jahre Bundesrat in Berlin
© REGIERUNGonline | Wienke
Veränderungen hat der Umzug von Bonn nach Berlin bewirkt. Durch sein repräsentatives Gebäude ist der Bundesrat heute in der Öffentlichkeit und besonders in den Medien deutlich präsenter, als er das in Bonn war.
Die vermehrte Aufmerksamkeit ist aber auch der guten Arbeit des Sekretariats zu verdanken und ich bin stolz auf die Ergebnisse, die wir gemeinsam erreicht haben. So haben wir die Bildungsangebote verstärkt und das Internetangebot und die Informationstechnik ausgebaut. Außerdem erfahren wir großen Zuspruch bei Besuchergruppen, deren Zahl stark zugenommen hat. Auch aus diesen Gründen steht der Bundesrat jetzt mehr im öffentlichen Licht, als das früher der Fall war.
Es sei bemerkt, dass wir dies auch ohne wesentliche Aufstockung des Personals erreicht haben. Weder der Beitritt der neuen Länder noch die Zunahme der Verfahren aus Brüssel haben zu einer wesentlichen Personalverstärkung geführt. Bei vielen anderen Behörden verlief diese Entwicklung in eine andere Richtung.
Nun zu etwas Persönlichem. Mit welchen Gefühlen gehen Sie am 30. September aus Ihrem Amt?

Interview mit Dirk Brouër
© Bundesrat | 2010
Mich beschleicht kein Gefühl der Wehmut. Ich freue mich für meinen Nachfolger, aber auch über meinen Nachfolger, der die letzten Jahre mein Stellvertreter war und mit dem ich ausgezeichnet zusammengearbeitet habe. Ich weiß, dass er das Amt in dem von uns gemeinsam getragenen Sinne weiter ausüben wird. Etwas Schöneres kann man sich doch zum Schluss kaum wünschen.
Welchen Rat geben Sie ihrem Nachfolger?
"Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen."
Biografie Dirk Brouër
Geboren am 12. September 1945 in Halle/Saale,
verheiratet, 5 Kinder.
Studium der Rechtswissenschaften.
1974 bis 1978 Richter am Verwaltungsgericht.
1978 bis 1990 Referent und Referatsleiter im Bundesministerium der Justiz.
1991 Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Leiter der Abteilung "Öffentliches Recht, Privatrecht, Rechtspolitik, Aus- und Fortbildungs- sowie Prüfungswesen".
Ab Februar 1999 Staatssekretär für den Bereich Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg.
Ab Oktober 1999 Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund.
Seit 01.05.2002 Direktor des Bundesrates.